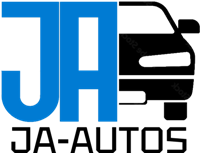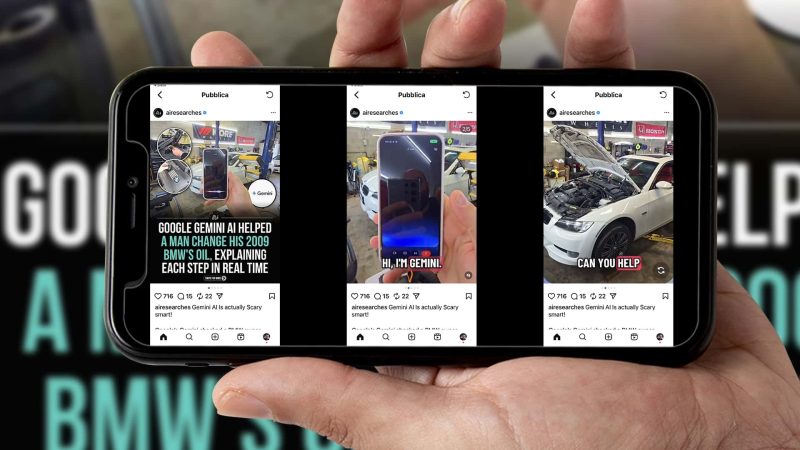Stellantis schlägt Alarm: EU-Autoziele 2030/35 in Gefahr – das droht uns allen!
Auf der IAA Mobility 2025 in München sorgte Jean-Philippe Imparato, Europa-Chef von Stellantis, für Aufsehen, als er die Erreichbarkeit der EU-Umweltziele für Neuwagen bis 2030 und 2035 als gefährdet bezeichnete. Seiner Einschätzung nach reichen Verkaufsförderungen für Elektrofahrzeuge alleine nicht aus, um die ambitionierten CO₂-Reduktionsziele zu erreichen, solange ein Großteil des Bestands aus älteren, emissionsstarken Modellen besteht.
Alte Fahrzeugflotte als größtes Hindernis
Imparato machte deutlich, dass sich unter den rund 256 Millionen in Europa zugelassenen Pkw gegenwärtig etwa 150 Millionen Fahrzeuge befinden, die älter als zehn Jahre sind. Diese Altfahrzeuge erzeugen laut aktuellen WLTP-Daten zwei- bis dreimal so hohe Emissionen wie moderne Neuwagen. Ohne ein breites Austauschprogramm und finanzielle Anreize für einen gesteuerten Flottentausch seien die EU-Ziele kaum zu realisieren.
Schwierige Lage bei leichten Nutzfahrzeugen
- Leichte Nutzfahrzeuge (VUL) sind für viele Gewerbetreibende unverzichtbar, doch hohe Anschaffungs- und Betriebskosten hemmen den Umstieg auf batterieelektrische Versionen.
- Ein unzureichend ausgebautes DC-Schnellladenetz und die schwereren Akkus reduzieren die Nutzlast und Rentabilität im täglichen Einsatz.
- Strenge CO₂-Vorgaben für VUL könnten ohne Ausnahmeregeln oder längere Übergangsfristen zum Wettbewerbsnachteil gerade für kleine und mittlere Unternehmer werden.
Imparato warnte: „Wenn die Politik das Tempo und die Härte der Vorschriften beibehält, gefährdet sie Wirtschaftlichkeit und Beschäftigung im gesamten Logistik- und Liefergewerbe.“
Vorgeschlagene Gegenmaßnahmen
Stellantis hat bereits eine Reihe von Vorschlägen an EU-Institutionen und nationale Regierungen unterbreitet, um die Ziele realistisch erreichbar zu machen:
- Ein großzügiges Prämienmodell für die Verschrottung von Fahrzeugen ab 10 Jahren, gekoppelt mit Kaufanreizen für BEV und PHEV.
- Stufenweise Lockerung der CO₂-Grenzwerte für VUL über mehrere Jahre, um Zeit für den Infrastrukturausbau zu gewinnen.
- Förderprogramme zur Modernisierung von Firmenflotten und Schulungsmaßnahmen für das Wartungspersonal von E-Nutzfahrzeugen.
- Finanzielle Zuschüsse für branchenübergreifende Ladeinfrastrukturprojekte, insbesondere entlang von Handelsrouten und in Gewerbegebieten.
Optimistische Stimmen trotz Risiken
Gegenstimmen betonen jedoch, dass technologische Fortschritte und sinkende Batteriepreise die Marktdurchdringung der Elektromobilität schneller vorantreiben könnten als bisher angenommen. Einige Experten rechnen damit, dass die Batteriekosten in den nächsten drei Jahren um weitere 30 % sinken und die Reichweiten durch neue Zellchemien auf über 600 km steigen. Sie argumentieren:
- Ein verbraucherfreundlicher Preisrückgang wird auch die einkommensschwächeren Käufergruppen für E-Autos öffnen.
- Fortschritte bei V2G- und bidirektionalen Ladesystemen können zusätzliche Einnahmequellen für Fahrzeugbesitzer schaffen.
- Politische Maßnahmen allein sind nicht alles – die Nachfrage wächst ohnehin, sobald das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.
Balance zwischen Umwelt, Industrie und Beschäftigung
Im Zentrum der Debatte steht die Frage, wie Europa seinen industriellen Kern stärken und gleichzeitig die Klimaziele einhalten kann. Für Stellantis ist klar: Nur eine pragmatische Mischung aus Innovationsförderung, abgestuften Übergangsfristen und flankierenden Maßnahmen für betroffene Branchen schafft die nötige Akzeptanz. Einseitig ausgelegte Vorgaben ohne Ausgleichsmechanismen könnten zu Produktionsverlagerungen, Entlassungen und langfristigem Vertrauensverlust bei Verbrauchern und Unternehmen führen.
Ausblick und Handlungsbedarf
In den kommenden Monaten werden die EU-Institutionen und Mitgliedsstaaten prüfen, inwieweit diese Vorschläge in die legislative Roadmap aufgenommen werden können. Für Automobilhersteller wie Stellantis ist entscheidend, dass sich die Weichen rasch in Richtung eines realistischen, sozialverträglichen Übergangs stellen. Denn: Je länger der Flottentausch hinausgezögert wird, desto höher die Gefahr, dass Europa seine Vorreiterrolle in der nachhaltigen Mobilität verliert.